Was Moldau über Wasser hält
VON CAROLIN GIßIBL

|
Achtzig Meter unter der Erde ist es kühl, die Luft feucht. Der Wagen schlängelt sich durch ein Tunnellabyrinth, vorbei an meterhohen Weinfässern. Cricova nennt sich die 120 Kilometer lange Unterwelt in Nähe der moldauischen Hauptstadt Chişinău – einer der größten Weinkeller der Erde. Mehr als eine Million Flaschen stapeln sich in Wandnischen, auf ihren Hälsen wölbt sich Staub. Die älteste ist Jahrgang 1902. Vor manchen stehen goldene Schilder mit eingestanzten Aufschriften: Sammlerwein, Eigentümerin Angela MERKEL. Daneben: Wladimir PUTIN. In der Wand gegenüber: Petro POROSCHENKO. Die politische Prominenz kennt Moldaus flüssige Schätze – für viele Weintrinker ist es unbekanntes Terrain.
„Wein ist Moldaus Motor.“ Tatiana Römischer holpert in einem Toyota über Schlaglöcher einer moldauischen Dorfstraße. Eine Schar Gänse wandert am Wegrand entlang, vereinzelt grast eine magere Kuh. Die 36-Jährige ist klein, quirlig. Ihr langes blondes Haar weht im Fahrtwind. Gelb, himmelblau, türkis sind die Häuser, die am Fenster vorbeiziehen. Weinreben ranken über die Gartenzäune. „Jeder in Moldau baut Wein an. Wir sind zwar ein armes Land, aber reich an Trauben.“
Der Segen kommt nicht von ungefähr: Die Republik Moldau liegt auf demselben Breitengrad wie Burgund, ist geprägt von kontinentalem Klima, das durch das nahe gelegene Schwarze Meer gemildert wird. Dreißig verschiedene Rebsorten wachsen auf der nährstoffhaltigen Schwarzerde. Schneearme Winter und lange Sommer begünstigen das Wachstum.
Wein hält das kleine Land über Wasser: Knapp 90 Prozent wird exportiert. „Zu Sowjetzeiten kam jede zweite Flasche, die in der UdSSR getrunken
wurde, von uns“, erzählt Römischer. Nach dem Zerfall der Sowjetunion blieb Moskau mit mehr als achtzig Prozent der Exporte wichtigster Abnehmer. Als Moldau Zollkontrollen
für Waren in der russlandaffinen Provinz Transnistrien einführen wollte, äußerte der russische Konsumentenschutz Qualitätsbedenken. Verunreinigungen, vor allem zu hohe
Schadstoffbelastungen, sollen gefunden worden sein. Der Kreml erließ 2006 ein Embargo, 2013 ein weiteres. „Das hat uns hart getroffen. Ein Viertel der Bevölkerung arbeitet in
der Weinwirtschaft. Viele der Weinlieferanten gingen pleite“, sagt Römischer.
„Wein ist das einzige Aushängeschild,
das Moldaus Namen nach außen
trägt."
Seither versucht sich Moldaus Weinindustrie neu zu erfinden, investierte in Technik, sucht neue Märkte. „Aber es ist schwierig“, erzählt sie. „Planwirtschaftliches Denken, bei dem eine Behörde die Menge und Qualität vorgibt, ist in vielen Köpfen verankert. Die Winzer tun sich schwer beim Marketing.“ Seit zwei Jahren arbeitet Römischer in einem Consulting, das Winzer beim Vertrieb nach Westeuropa berät.
Sie selbst lebte zehn Jahre lang in Deutschland, studierte „Internationale Weinwirtschaft“ in Geisenheim, bis ihr deutscher Mann sie überzeugte, gemeinsam in ihr Heimatland überzusiedeln: Moldau sei voller Möglichkeiten. Römischer gefiel der Gedanke. Weil sie darin eine Chance sah, ihrem Land etwas zurückzugeben. „In Moldau wird fast alles importiert. Wein ist das einzige Aushängeschild, das Moldaus Namen nach außen trägt. Die Leute müssen nur davon erfahren.“
Heute ist sie auf dem Weg zu einem Winzer mit eigener Kellerei. „,Et Cetera‘ hat sich mit Sorten wie Merlot, Chardonnay und Cabernet Sauvignon sowie mit einheimischen Weinreben einen Namen gemacht.“ Eine ist Fetească Neagră – schwarz-violett und prall. Die runde Traube ist ein Sinnbild für Moldaus lange Weintradition. Seit mehr als 2000 Jahren wird sie im Weinbau genutzt, hat extremer Kälte, Trockenheit und Fäulnis standgehalten.
|

|
Am Ende einer drei Kilometer langen Walnussbaum-Allee führt eine Abzweigung auf einen Kiesweg. Links und rechts beugen sich Weinreben dem Wind. Das Gut liegt in Crocmaz, am Ufer des Dnister und nahe dem Schwarzen Meer. Neben dem Parkplatz ruht ein Landhaus aus Klinkerstein mit Fensterfassade und überdachter Holzterrasse. Eine Arbeiterin verteilt davor Weingläser an eine Besuchergruppe. Einer lehnt ab: „Ich hatte heute schon genug.“ Es ist Alexandru Luchianov, Besitzer des Familienbetriebs. Groß, sportliche Figur, Jeans. Sein Hemd hat Flecken. Der 49-jährige Geschäftsführer packt oft selbst mit an, kontrolliert jeden Schritt – vom Ernten über Fermentieren zum Servieren.
Als junger Mann arbeitete Luchianov als Tauchlehrer und Fallschirmspringer, unter anderem in Thailand, Ägypten, Spanien, der Karibik. In den USA bot er seinen Kollegen einmal einen Wein aus Moldau an. Sie waren schockiert: „Ich dachte, Moldau produziert guten Wein?!“, beanstandete einer. Luchianov, der noch keine Ahnung von Wein hatte, begann sich mit der Wissenschaft zu beschäftigen, beschloss Winzer zu werden, kaufte zusammen mit seinem Bruder Igor ein Grundstück, baute die Marke „Et Cetera“ auf. „Es war nie ein Geschäft, sondern immer unser Lebensabenteuer,“ bezeichnet er es heute und blickt dabei auf sein Anwesen, das sich stetig erweitert: ein Restaurant, ein Hotel, ein Pool, sogar eine Landebahn für eine Cessna, die er sich hin und wieder für Geschäftsreisen anmietet.
Die Besucher sind Belgier, die von Moldaus hochwertigem Wein erfahren haben. „Wir dachten, wir schauen uns das Land an, von dem wir nicht einmal wussten, wo es liegt.“ Sie betreten die Produktion, wo drei Meter hohe Edelstahltanks den Raum füllen. Plastiketiketten beschreiben den Inhalt. „Zisterne 41: Carménère, 2017, 14%.“ Luchianov zapft rote Proben. Ein Mann schwenkt sein Glas auf Augenhöhe, schnüffelt daran: „Ein würziges Bukett. Elegant.“ Luchianov stimmt zu: „Der ist fruchtig, rund und harmonisch mit Nuancen von Kirschen und weißem Pfeffer.“ Er geht zur nächsten Zisterne: „Cuvée Rouge, Premium 2015, 13,77%.“ Ein Verschnitt aus Merlot, Cabernet, Saperavi und Rara Neagra. Rassige Säure, spritzig, trocken und beeriges Aroma. Die Gäste sind sich einig: „Super!“
„Von Moldau wird Wein zu Discounterpreisen erwartet. Günstigen Wein zu produzieren würde uns killen."
Am Ende der Führung kaufen die vier Teilnehmer nur drei Flaschen. „Es schmeckt sehr gut. Aber wir bleiben unseren französischen Weinen aus Bordeaux und Burgund treu.“ Luchianov kennt dieses Problem. Seine Weine wurden mehrfach preisgekrönt. Der Verkauf auf dem europäischen Markt sei dennoch schwer: „Im Westen gibt es zu viel Konkurrenz. Frankreich, Italien, Österreich, Deutschland. Von Moldau wird Wein zu Discounterpreisen erwartet. Aber wir haben einen Qualitätsanspruch. Günstigen Wein zu produzieren würde uns killen.“ Daher orientiert sich „Et Cetera“ mehr und mehr Richtung Osten. Hauptabnehmer: China. Es wurde ihm angeboten, Solaranlagen gegen Wein zu tauschen. Er denkt darüber nach.
Viele Winzer erhöhen ihre Exporte nach China. Moldau liegt an der „Neuen Seidenstraße“ und ist ein potentiell wichtiger eurasischer Handelspartner. 2016 stieg der Export moldauischer Flaschenweine nach China um 66 Prozent. Römischer, die Weinexpertin, sieht diese Entwicklung kritisch: „Unsere Weinbauern wollen große Abnehmer. Aber sie müssen lernen umzudenken: Was ist verkehrt daran, die gleiche Menge zu exportieren, aber auf den Märkten zu verteilen? Unsere Weinindustrie darf nie wieder in so eine wirtschaftliche Abhängigkeit geraten wie vor dem Embargo.“ Derzeit bereiten beide Länder ein Freihandelsabkommen vor, das Ende 2018 unterzeichnet werden soll.
Vielleicht wird es nicht mehr lange dauern, bis auch der chinesische Präsident Xi Jinping seine Weinsammlung im Weinkeller Cricova lagert. |

|
HINTER DER RECHERCHE
Sechs verschiedene Orte und überall zur Begrüßung ein Glas Wein in die Hand gedrückt bekommen – die Recherche hätte unangenehmer sein können. Beinahe wäre sie es geworden, als ich mich im riesigen Weinkeller Cricova fast verirrte. Dem ersten Menschen im Weltraum, Juri Gagarin, soll dies nach einer Weinprobe tatsächlich passiert sein: Zwei Tage später wurde er gut beschwipst in der Unterwelt wiedergefunden. |
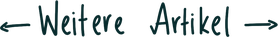

Drama im Bunker
Nicoleta Esinencu wird für ihre kritischen Theaterstücke geschätzt – im Ausland. In ihrer Heimat dagegen kaum beachtet.

Reiseführer in einem Staat, den es nicht gibt
Transnistrien wird von niemand anerkannt und dennoch hat das Land eine eigene Währung, eine eigene Fahne und einen Sowjetstern auf dem Rathaus. Und einen Touristenführer.
