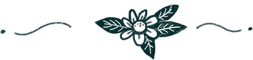VON NORA BELGHAUS

|
Dreizehn Reporter reisen. In ein Land, das nur einer von ihnen flüchtig kennt. Der Rest hat vor der Reise in die Republik Moldau vor allem ein Bild im Kopf: osteuropäisch, also arm. Die Darstellung in den Medien kreist unaufhörlich um den Handel mit Menschen und Organen, Abwanderung und Arbeitslosigkeit, um verwaiste Kinder in verlassenen Dörfern, Unterentwicklung und Perspektivlosigkeit. Eine Woche vor Abflug fragen wir uns: Im Osten nichts Gutes? Soll es das sein?
Wir laden eine in Deutschland lebende moldauische Lehrerin in die Schule ein und fragen sie, was sie von der Repräsentation ihres Landes in deutschen Medien hält. Sie wünsche sich mehr Vielfalt, mehr Positives, erwidert sie. Wir nehmen uns vor, zögerlich mit der Themenfindung zu sein und nicht mit von Stereotypen getrübter Sicht schon zigmal erzählten Geschichten hinterherzujagen.
Und noch etwas nehmen wir uns vor. Wir wollen beobachten, was es macht, als westeuropäische Reporter und Reporterinnen in einem osteuropäischen Nachbarland der EU zu recherchieren. Mit uns wie mit den Geschichten, die wir uns zu eigen machen.
Wir stellen also nicht nur unseren Protagonisten und Protagonstinnen, sondern auch uns selbst Fragen. Zum Beispiel: „Wir“ und „die anderen“ — muss man diesen Graben graben? Wie nehmen wir Land und Leute wahr und durch welche Brille schauen wir dabei? Wo verstecken sich Vorurteile oder Stereotype? Welche Auswirkungen hat das auf unsere journalistische Praxis? Und an welchen Stellen werden sie in unseren Texten sichtbar? Auf viele dieser Fragen haben wir keine endgültigen Antworten gefunden. Aber wir haben darüber nachgedacht und es aufgeschrieben.
Wir und die anderen
Am zweiten Tag unserer Reise lernen wir die Übersetzer und Übersetzerinnen kennen, auf deren Unterstützung wir zwei Wochen lang angewiesen sein werden. Sie kommen aus der Republik Moldau, sind im gleichen Alter wie wir, haben eine ähnliche Ausbildung genossen. Man fühlt sich vertraut und doch irgendwie fremd.
Wir sitzen gemeinsam in einem Stuhlkreis in unserer improvisierten Redaktion im Frühstücksraum unseres Hotels. Wir stellen auf Englisch unsere Themen vor. Einige von uns rutschen nervös auf ihren Stühlen hin und her. So richtig sitzen sie noch nicht, unsere Vorhaben und Ideen. Wie auch, so ahnungslos, wie wir uns fühlen, in den ersten Tagen in Moldau. Nach Abschluss der Runde fragen wir unsere neuen Kolleginnen, ob sie etwas vermissen. Eine Übersetzerin sagt:
„Es wäre schön, wenn eure Geschichten nicht nur auf Aspekten aufbauten, die uns von euch unterscheiden. Wenn sich nicht alles um Sowjet-Nostalgie, Armut und Weltfremdheit dreht."
Damit war der blinde Fleck offengelegt. Wir sollten erfahren, wie schwer es ist, unsere westlichen Brillen abzulegen, mit denen wir wie instinktiv nach dem Exotischen im Fremden suchten.
Fabian zum Beispiel machte sich genau darüber schon zu Beginn der Reise Gedanken. Er hatte Angst, dass ihm in Moldau jemand ins Gesicht sagen würde: „Du bist doch nur hier, weil wir arm sind“. Er fürchtete den Vorwurf: „Die abgesicherten, wohlhabenden Westeuropäer zockeln mal schön zehn Tage durch ein fremdes Land und denken, sie könnten die Situation der Menschen verstehen“.
Er nahm sich fest vor, den Menschen in Moldau mit der größtmöglichen Offenheit und Unvoreingenommenheit zu begegnen. Das erste Treffen mit seinem Protagonisten, einem Unternehmer im Agrarbusiness, beschreibt er so:
„Timur Muradov begrüßte mich in einem Café. In der einen Hand hielt er die Aktentasche, in der anderen sein Handy. So würde ich ihn auch in Zukunft antreffen, immer auf Hochtour. Wir redeten und rauchten, über zwei Stunden lang. Er erzählte so viel aus seinem Leben, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, er müsse mindestens 40 sein. Ich unterbrach ihn: ‚Wie alt sind Sie denn eigentlich?’ — ,29’, sagte er."
Später ertappte Fabian sich beim Schreiben:
„Ich hatte in meinem Text stehen, ‚mein‘ Protagonist spricht ‚perfektes Business-Englisch’. Und dann dachte ich: Das muss sofort wieder raus! In Deutschland würde ich in einem Portrait über einen studierten, jungen Geschäftsmann niemals schreiben, dass er perfekt Englisch spricht."
Fabian tappte trotz aller Vorsicht in die Vorurteilsfalle, und konnte doch noch entkommen.
|

|
Alles „gender“ oder was?
Immer wieder diskutieren wir während der Reise zudem die Frage, ob sich genug Frauen unter unseren Protagonisten befinden. Es hatte sich gefügt, dass nach der ersten Woche in Moldau die Mehrzahl unter ihnen männlich war. Woran lag das? War es dem Zufall geschuldet oder spiegelte sich darin eine patriarchale Gesellschaft? Leonie ärgerte sich über sich selbst. Ausgerechnet sie, die „das Schild mit ‚mehr Frauen‘" besonders hochhielt, wählte einen homosexuellen Mann zur Hauptfigur. Für sie stand fest:
„Homosexuell hin oder her – mein Protagonist bleibt ein Mann. Bei so einem Projekt sollte man sich früh Gedanken machen, welche Gruppen man wie abbilden möchte.“
Wir überlegten, ob wir bei diesem Spiegel der Verhältnisse bleiben oder gegensteuern sollten, indem wir die Zahl der weiblichen Figuren in unseren Geschichten erhöhten. Die Diskussion drehte sich darum, ob wir uns an diesen Kategorien überhaupt orientieren wollten. Wollten wir nicht in erster Linie Geschichten von Menschen in Moldau erzählen? Inwiefern spielte ihr Geschlecht da eine Rolle? Musste eine Quote her? Der Kurs blieb sich uneinig. Am Ende fügte es sich ganz ohne Zwang zu einem Verhältnis von sieben Frauen zu drei Männern.
Apropos gender. Wir haben lange mit uns gerungen, wie wir in den Texten mit der Schreibweise von männlichen und weiblichen Formen umgehen. Die Mehrheit des Kurses sprach sich schließlich zugunsten der Lesbarkeit für einen allgemeinen Passus aus. Es gilt also: „Nachfolgend werden nur männliche Formen verwendet, gemeint sind dabei jeweils beide Geschlechter.“
Das Transparenz-Dilemma
Einige beschäftigte das Thema Transparenz und Vertrauen. In der Theorie ist allen klar: Journalismus soll auf Augenhöhe stattfinden, und dazu muss er transparent sein. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Elisabeth begleitete den Totengräber Ruslan Volosin. Sie sprach auch mit seinen Vorgesetzten über die Exhumierungen und beschreibt eine Recherche-Situation so:
„An einem Vormittag rief mich mein Protagonist an. Ruslan Volosins Stimme klang hart. Er sagte: ‚Kann ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?‘ Es klang nicht wie eine Frage. ,Warum haben Sie sich über mich beschwert, bei meinem Chef?’ Ich konnte mir nicht erklären, wie er überhaupt darauf kam. Erst nach ein paar Minuten, nachdem wir das Missverständnis ausgeräumt hatten, wurde seine Stimme weicher, taute er ein wenig auf.“
Elisabeth spürte, dass ihr Protagonist sie auf Distanz hielt, gar misstrauisch war. Sie vermutete, dass es daran lag, dass sie die fremde Journalistin war, die alles über ihn wissen wollte, aber kaum etwas über sich preisgab. Es beschlich sie das Gefühl, Ruslan Volosin bis zuletzt nicht wirklich begreiflich gemacht haben zu können, wer sie war und welches Ziel sie verfolgte.
Auch Daniela fiel es schwer, ihre Rolle als Journalistin zu vermitteln. Sie kämpfte jedoch nicht mit Misstrauen, sondern im Gegenteil — gegen zu viel Nähe. Sie interviewte Maia Taran. 13 Jahre war sie von ihrem Mann misshandelt worden und lebte in ärmlichen Verhältnissen. Daniela erzählt:
„Drei Stunden lang saß ich mit meiner Protagonistin an ihrem Küchentisch, neben mir die Übersetzerin. Sie bat uns Kaffee an, nahm sich Zeit, beantwortete geduldig meine Fragen. Sie wollte, dass ihre Geschichte erzählt wird. Und dann kam er, der Moment, in dem ich das Aufnahmegerät ausschaltete und mich vom Stuhl erhob. Wir lächelten uns an, die Übersetzerin setzte an zu übersetzen. Doch in diesem Moment brauchte ich keine Übersetzung. Ich sah das Haus, das weder vor Kälte noch vor Regen schützte. Ich sah ihre vier Kinder. Ich sah Maia Taran, die seit den Misshandlungen ihres Mannes arbeitsunfähig ist. Die Übersetzerin drehte sich zu mir um: ,Sie fragt, ob du ihr Geld geben kannst.' Ich schluckte. Was sollte ich tun?“
|

|
Maia Taran gewährte der fremden Journalistin einen tiefen Einblick in ihr Leben, sie kamen sich emotional nah. Daniela trat in ihrer professionellen Rolle in das Leben der Protagonistin, doch die ethischen Prinzipien ihres Berufes kollidierten mit ihren moralischen Grundsätzen als Person. Daniela drückt es so aus:
„Meine Erklärungen, warum ich eigentlich weder etwas annehmen noch geben durfte, waren weder für sie noch für mich zufriedenstellend. Als Journalistin muss man solchen Schicksalen theoretisch neutral gegenübertreten. Als Mensch fühlt sich genau das falsch an."
Am Ende gab sie der Frau etwas Geld aus ihrer privaten Reisekasse.
Armin wiederum fragte sich, wie weit seine Verantwortung reichte. Er beschäftigte sich mit dem einzigen internationalen Hafen von Moldau. Er glaubte, an einer Erfolgsgeschichte dran zu sein, bis er Dinge herausfand, die ihn daran zweifeln ließen. Er fragte sich:
„Kann ich die Hafendirektion in dem Glauben lassen, ich würde eine positive Geschichte über ihr Projekt machen, auch wenn ich das Gefühl habe, es wird eher eine negative?“
Eine Abwägungssache. Armin war auf die Bereitschaft seiner Protagonisten angewiesen, sich ihm zu öffnen. Würde er sie darauf hinweisen, dass trotz freundlicher Interviews eine kritische Geschichte dabei rauskommen könnte, verbaute er sich womöglich seine Recherche. Er versuchte, einen Mittelweg zu finden und in den folgenden Gesprächen mit ein wenig mehr professioneller Kälte aufzutreten. Er ist sich noch immer unsicher, ob ihm das gelungen ist.
Ende gut, alles gut?
Nach dreizehn Tagen waren zu den wenigen Puzzleteilen, die jeder von uns im Geiste mit nach Moldau gebracht hatte, etliche dazugekommen. Vor unserem inneren Auge war das Land kein weißer Fleck am Rand der EU mehr, sondern ein buntes Sammelsurium an Eindrücken.
Eine große Frage bleibt bis zuletzt: Sind wir unserem Anspruch, die Republik Moldau facettenreich abzubilden, ohne Negatives zu verharmlosen oder das Fremde zu exotisieren, gerecht geworden?
Antwort darauf können vor allem diejenigen geben, die mit einem frischen Blick von außen auf dieses Projekt schauen: Über Rückmeldungen freuen wir uns sehr! |