Wie ich mir eine neue Familie suchte
VON FRANZISKA PESCHEL

|
Es ist sieben Uhr abends, als ich den Fluss Dnister überquere. Zum letzten Mal heute steuert der Fährmann seinen Kahn zum Anleger des Dorfes Molovata. Der letzte Bus zurück in die Hauptstadt ist vor zwei Stunden gefahren. Das wusste ich nicht.
Zum Flussbett hin fallen grüne Hänge ab. Zwei Dörfer, durch die Fähre verbunden, sind die einzigen besiedelten Gebiete in Sichtweite. Ich wollte das Land erkunden, seine Menschen kennenlernen, raus aus dem Hotel, raus aus der Stadt. Jetzt stehe ich an einer Schleife des Dnister, sechzig Kilometer von der Hauptstadt Chişinău entfernt und komme nicht weiter.
Als ich die Uferstraße entlangschlendere, kommt Jore auf mich zu. Er trägt staubige Sportschuhe, auf seiner Jogginghose steht „Abibas". Er bietet an, mir ein Taxi zu rufen. Von seinem Haus aus. „Nein, danke“, winke ich ab. Mit fremden Männern gehe ich meistens nicht nach Hause. Doch nach der dritten Aufforderung scheint es mir unhöflich, zu widersprechen. Er zeigt auf ein goldenes Kreuz, das an seinem Hals hängt. „Ich bin ein ehrlicher Mann.“ Na dann, denke ich. Was sollte ich sonst tun? In einem Dorf, in dem niemand meine Sprache spricht. In dem es weder Bahn noch Bus, nicht einmal Straßenschilder gibt. Jore drückt mir drei Lollis in die Hand, die soll ich seinen drei Kindern geben. Dann folge ich ihm eine der wenigen asphaltierten Straßen den Hügel hoch.
Das bisschen Russisch und Rumänisch, das ich spreche, haben mich bis hierhin gebracht. Aber Jore stellt weiter Fragen. Verlegen zucke ich mit den Schultern. „Ja ne ponimaju.“ Ich verstehe nicht.
Sein Grundstück ist Garten und Feld zugleich. Obstbäume. Ein blaues einstöckiges Haus mit Blick über das Dorf und den Dnister. Ein Brunnen. Geröll, Staub und Müll. Es duftet nach Akazien, die hinter dem Haus weiß blühen. Vorn wachsen Knoblauch, Kartoffeln, Minze. Ich bin so beflügelt von der Schönheit, dass ich den Dreck kaum wahrnehme, die Trümmer des Hühnerstalls, der unter dem Schnee des vergangenen Winters eingestürzt ist, samt aller Vorräte im Keller.
Jore ruft nach seiner Frau, Genia. Ihr Name klingt für mich wie „Gena“, das russische Wort für Ehefrau. Sie streckt ihr rundes gebräuntes Gesicht aus dem Haus, legt es in Falten, als sie mich sieht. Ob ich hier willkommen bin? Schnell drücke ich den Kindern Octavian, auf ihrem Arm, und Michaela die Lollis in die Hand. Den dritten lege ich auf die Veranda. Der Sohn ist nicht zu Hause. Michaela ist fünf Jahre alt, ein blondes Mädchen. Sie kneift die Augen zusammen, als sie mich mustert.
Ich bin gerührt. Von dem Alltag, der ohne Überraschungen vorbeifließt wie der Fluss unten im Dorf.
Sie hat eine kleine Verletzung an der Stirn. Mit dem Daumen streicht Jore über die Stelle, an der sich Schorf bildet, nimmt ihren Kopf zwischen seine Hände. Unter den Fingernägeln Erde und Schmutz. „Was hast du da schon wieder gemacht?“, will er von ihr wissen. Sie sprechen rumänischen Dialekt mit einigen russischen Wörtern. Sie zuckt mit den Schultern und beide lachen.
Jore drückt meine Hand in die seiner Tochter. Sie soll mir den Garten von oben zeigen, führt mich durch einen kleinen Wald hinter dem Haus einen Hügel hinauf. Achtsam setzt sie einen Fuß vor den anderen. Als ich meine Hand aus ihrem festen Griff löse und mit großen Schritten hochklettere, hüpft sie fröhlich hinter mir her.
Ihre Mutter ist erst 28. Kaum älter als ich. Michael, den ältesten Sohn, hat sie mit siebzehn zur Welt gebracht. Sein Vater ist nicht Jore, sondern Genias Ex-Freund. „Er hat mich betrogen und schlecht behandelt. Dann hat mein Vater ihn fortgejagt. Jore hat Michael wie seinen eigenen Sohn aufgezogen. Ich hatte Glück, ihn zu treffen“, erzählt sie mir am nächsten Tag. Ihre Stimme plätschert dahin. Sie schaut an mir vorbei ins Nichts.
Als es langsam dämmert, stellen Jore und ich unsere Schemel auf die trockene Erde unter dem Obstbaum. Blicken über die unverputzte Gartenmauer hinweg auf die Landschaft. Er sorgt sich um seine Kinder. Fragt sich, was er tun könne, damit sie eine gute Zukunft haben.
Ich bin gerührt. Von dem Alltag, der ohne Überraschungen vorbeifließt wie der Fluss unten im Dorf. Ich bewundere Jore und Genia, deren Sorgen allein den Kindern gelten. Sie plagen sich nicht wie ich mit der Frage, ob die löchrige Hose noch tragbar ist, ob es ungesund ist, wieder Nudeln statt Rohkost zu essen, auf welchen Joghurt die Wahl am Supermarktregal fällt. Ich knabbere an einem Knoblauchhalm. Und verstehe kaum die Hälfte von dem, was Jore mir erzählt.
Irgendwann kommt ein Taxifahrer. Die Zeit hat hier kein festes Tempo.
|

|
Als ich das nächste Mal nach Molovata komme, mit Übersetzerin, ist die Skepsis in Genias Gesicht verflogen. Ich habe die löchrige Hose an. Und bin froh, wieder hier zu sein. Fern von Terminen, Telefonaten und Lärm.
Erst nach dreimaligem Klopfen rührt sich etwas im blauen Haus. Die ganze Familie hat geschlafen. Es ist halb sechs am Nachmittag. Von Weitem habe ich Balkan-Pop aus dem Haus dröhnen gehört, in einer Lautstärke, die mich an meine schwäbischen Nachbarn denken lässt. Ob sie wohl gleich mit einer Beschwerde hier vor der Tür stehen?
„Bring Zigaretten mit“, hatte Jore mich gebeten. Eine Packung Camel in der Tasche, komme ich bei ihm an. Er verdient umgerechnet zweihundert Euro im Monat auf dem Bau. Falls er Aufträge bekommt. Sechs Euro zahlen sie monatlich für Michaelas Kindergarten. Wenn sie es vergessen, schreiben die Erzieher den Kindern eine Mahnung auf den Arm. Dabei sind moldauische Kindergärten im Prinzip kostenlos.
Seit Langem spielen Genia und Jore mit dem Gedanken, die Kinder in der Obhut ihrer Großeltern zu lassen und im Ausland zu arbeiten. Bisher konnten sie sich nicht dazu entschließen, auch wenn das Geld für vieles nicht reicht.
Wir verhandeln über Ware und Preis.
Zwei Kilo Innereien vom Schwein. Drei
Euro.
Verschlafen treten die beiden aus dem Haus. Mit einer Kaffeetasse schöpft Genia Brunnenwasser aus dem Eimer und gießt es ihrem Mann in die Hände. Er wäscht sich das Gesicht. „Ich könnte nicht bei der Musik schlafen“, wundere ich mich. „Der Wein hilft dabei“, brummt Jore. „Wollen wir essen?“ Jore deutet auf eine Art Grill: eine gusseiserne Platte auf Füßen. „Hast du Geld für Fleisch?“ Ich bin froh, etwas beisteuern zu können, nachdem die Familie alles mit mir geteilt hat. Wir gehen einen staubigen Weg hinunter zum Laden. Jore klingelt eine Frau im Hauskleid heraus, die in die Tiefkühltruhe schauen lässt. Gemeinsam begutachten sie ein Paket eingeschweißtes Fleisch, verhandeln über Ware und Preis. Zwei Kilo Innereien vom Schwein. „Du sollst ihr drei Euro geben“, übersetzt die Übersetzerin.
Zu Hause schichtet Jore Holzscheite unter den Grill und gießt den letzten Rest Benzin aus einer Motorsäge über ein Stück Holz, entzündet damit das Feuer. Um das gefrorene Fleisch zu zerkleinern, holt er eine Axt. Ich sehe ihn damit ins Haus gehen. Im Flur steht Michael und zuckt zusammen, wenn sein Vater draufhaut.
Jores richtiger Name ist Gheorge. Aber Jore passt gut. So nennt man scherzhaft Männer vom Land. Sie reden viel. Sind unbedarft. „Trinkst du Wein?“, fragt er, holt einen Krug aus dem Haus. „Trink.“ Von meinem ersten Abend kenne ich das kleine Marmeladenglas, aus dem alle trinken. Jore füllt es für jeden neu. Noch immer klebt Schmutz am Boden. Der Wein schmeckt säuerlich. Die Übersetzerin lehnt ab. Meine Freude teilt sie nicht. Und sie kann auch nach der dritten Aufforderung „Nein“ sagen. Sie fühlt sich nicht wohl bei diesen Leuten, die sie nicht kennt, die ihrem behüteten Stadtleben so fern sind. Ich dagegen möchte am liebsten hierbleiben.
Genia bereitet inzwischen Zwiebeln und Kartoffeln vor. Innen ist das Haus dunkel, drei kleine Räume, in einem ein Gasherd mit zwei Brennern. Die Luft riecht muffig. Feuchtigkeit dringt durch die Wände. Dampfschwaden vom Herd kommen dazu. In jedem Raum ein Bett. Ein Fernseher. Ein Laptop. Wlan gibt es. Küche und Bad nicht.
Während das Fleisch auf dem Grill gart, schiebt ein Arbeitskollege von Jore sein Rad in den Garten. Auf dem Gepäckträger eine Plastikflasche mit anderthalb Liter hausgemachtem Wein. Zwei weitere Freunde trudeln ein. Sie verziehen das Gesicht, als sie den Wein probieren. Er ist noch saurer als der, den Genia von ihren Nachbarn holt. Sie essen, scherzen mit den Kindern und wirbeln sie in der Luft herum. Tanzen mit Genia und den Kindern im Garten zu den immer gleichen sechs Liedern, die aus der Box auf der Veranda dröhnen. Jore hat die Box nach draußen gestellt. Als wolle er dem ganzen Dorf zeigen, dass sie heute feiern. Dass sie einen Gast haben. |
|
Am Mittag ist es ruhig bei Jore und Genia. Ich bin dieses Mal früh am Tag gekommen. Um dem Wein zu entgehen. Michael ist in der Schule. Michaela im Kindergarten. Auf der Veranda wärmt die Sonne Wasser in einer Wanne auf, später werden die Kinder darin baden. Octavian, ein Jahr alt, schmeißt mit beiden Händen Erde hinein.
Jore wässert mit dem Gartenschlauch die Erde. Er möchte Tomaten pflanzen. Seine Mutter, eine zierliche Frau mit Kopftuch, drückt ihm die Keimlinge in die Hand. Sie ist gerade von der Arbeit auf dem Feld nach Hause gekommen, macht auf dem Rückweg einen Abstecher bei ihrem Sohn. Ihr Haus liegt nur einige Meter die Straße herunter. Sie vergewissert sich, ob er alles richtig macht. „Setz die Reihen nicht so dicht. Ist der Boden feucht genug?“ Ihr faltiges, tief gebräuntes Gesicht spricht von einem arbeitsamen Leben.
„Immer, wenn du hier bist, ist es aus mit unserer Ruhe“, stöhnt Jore und holt aus dem Haus den Tonkrug mit Wein. Zieht sich und mir einen Schemel in den Schatten der Hauswand. Seine Mutter braucht keinen Schatten. Den Kopf im Nacken sieht mich die kleine Frau herausfordernd an. „Ich bin an die Sonne gewöhnt.“ Argwohn schwingt mit, als sie vor mir ihr Glas hebt. „Wir können viel Wein trinken, weil wir so viel arbeiten“, behauptet sie.
Erst als ich barfuß den steinigen Weg zu ihrem Haus gehe, auf Rumänisch bis zehn zähle und ihr zeige, dass ich tanzen kann wie sie es tut, drückt sie mir einen Kuss auf die Wange und lacht.
Am Abend sitzt Genia zwischen mir und ihren Kindern. Froh und sanft sieht sie aus, wie ich mir einen Engel vorstelle. „Ich bleibe bei dir“, scheint sie Octavian versichern zu wollen, der auf ihrem Arm thront.
Als ich zum letzten Mal durch das rostige Gartentor nach draußen trete, atmet die Übersetzerin erleichtert auf. Die kleine Michaela weint. Der Fahrer aus Chişinău drängt. Die Rückkehr in mein Leben drückt meine Flügel nach unten. |
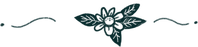
GENIA,
WAS WÜNSCHST DU DIR FÜR DEINE ZUKUNFT?
|
HINTER DER RECHERCHE
Auf das Thema bin ich durch einen Zufall gestoßen – und eine Notsituation. Ich wusste nicht, wie ich aus dem Dorf zurückkommen sollte und wurde kurzerhand von Jore und Genia in ihr Haus eingeladen. Dass die Familie so herzlich zu mir war, hat mich berührt. Ihre einfache Lebensweise fasziniert. Ich wollte eine Geschichte schreiben über das Alltägliche, über Menschen, die keine Helden sind. Also habe ich mit ihnen gegessen, gefeiert und eingekauft, die Eltern besucht und die Zeit totgeschlagen. Ich habe mich drei Tage lang in ihr Leben hineingesetzt. |


Schwul in Gagausien
Andrej Kolioglo ist der Einzige seines kleinen Volkes, der sich geoutet hat. Jetzt kehrt er in sein Dorf zurück, zu Menschen, die ihm Gewalt androhen.

Maia wollte sterben
Fast wäre Maia Daran von ihrem Ehemann totgeschlagen worden. Heute hilft sie anderen Frauen, denen es ähnlich erging wie ihr.


























