Die Republik Moldau hat 430 Meter Zugang zum Meer. Und die kontrolliert ein Deutscher
VON ARMIN GHASSIM

|
Im Minutentakt wackelt die Wand. „Vor ein paar Wochen soll es hier ein Erdbeben gegeben haben. Wir haben nichts bemerkt. Durch die Lastwagen haben wir jeden Tag Erdbeben.“ Katerina Kanja trägt ein beiges Kopftuch mit Blumenmustern. Darunter schauen kastanienfarbige Haare hervor. Die Augen kneift sie zusammen, ihr Blick erzählt von einem mühsamen Leben. Fünfzig Euro monatlich verdient sie durch Putzen. Sie zeigt auf tiefe Risse, die sich durch die Fassade ihres Hauses ziehen. Eine Folge des starken Verkehrs, wie bei vielen Häusern an der Hauptstraße. „Wie soll ich von meinem Verdienst die Reparaturen zahlen?“, fragt sie.
Walnussbäume, Pinien, Sauerkirschen- und Aprikosenbäume säumen die Hauptstraße des 3.000-Seelen-Dorfes am südlichsten Punkt Moldaus. Alle marinen Exporte und Importe des Landes passieren die Häuser von Katerina Kanja und den anderen Dorfbewohnern. Zur Getreideernte im Spätsommer stauen sich die Lastwagen durch das gesamte Dorf. Die Straße mündet in einer T-Kreuzung. Links geht es einige hundert Meter bergauf zur ukrainische Grenze, rechts keine zwei Kilometer bergab zum Grenzfluss Prut. Am anderen Ufer liegt Rumänien. Geradeaus ein mannshoher Metallzaun, dessen Öffnung durch einen Schlagbaum versperrt wird, der Eingang zum Hafen.
Nur 430 Meter Donau besitzt Moldau. Durch einen Landtausch mit der Ukraine im Jahr 2005 erwarb der Binnenstaat dieses strategisch wichtige Stück Ufer. Bis dahin war das Land auf benachbarte Häfen in der Ukraine und Rumänien angewiesen. Giurgiulești ist Moldawiens Tor zur Welt, gehört heute aber einem niederländischen Unternehmen mit Sitz in Wien, unter der Leitung eines Deutschen.
Der internationale Freihafen ist komplett umzäunt. Schon aus der Ferne mustern die Sicherheitsmänner jedes Auto, jede Person, die auf das Gelände zusteuert. Innerhalb des Hafens gibt es eine weitere abgeriegelte Fläche: Eine weiße Mauer hegt das blitzsaubere, weiß-graue Bürogebäude von Donau Logistik ein.
Heute kann kein Moldauer ans Ufer der moldauischen Donau treten, ohne die Erlaubnis der deutschen Hafenbetreiber einzuholen.
Drinnen empfängt Dr. Mathias von Tucher, promovierter Ökonom aus München. Adrett hellblaues Hemd, Ray-Ban-Brille mit Rahmen, das wenige Haar an den Schläfen ist grau und kurz geschoren. Er ist Betriebsleiter bei Donau Logistik. Durch eine große Fensterfront scheint das Sonnenlicht in den Konferenzraum. Makellos weiße Wände verstärken das Licht. Draußen ist es warm, windig, betriebsam. Drinnen kühl, leise, steril.
Von Tucher ist ein Freund des Inhabers Thomas Moser. Beide arbeiten von der Hauptstadt Chișinău aus und kommen nur gelegentlich nach Giurgiulești. Er setzt seine Sonnenbrille auf und führt in seinem Geländewagen durch den Hafen, zeigt die neuen Pipelines für Pflanzenöl, die silbrig schimmernden Kornspeicher, die Flexi-Tanks, in die 24.000 Liter Wein passen.
„Im Jahr 2007 lief das erste Schiff ein“, erklärt von Tucher, „heute werden jährlich fast eine Million Tonnen ein- und ausgeschifft, das ist sehr viel für einen Flusshafen.“ Etwa vierhundert Schiffe verlassen den Hafen im Jahr, meist mit Getreide, Pflanzenöl oder Wein an Bord. Sie fahren in den Mittelmeerraum, aber auch bis nach Südostasien und Nordamerika. Importiert wird vor allem Treibstoff. Diesel und Benzin, die hier landen, machen rund die Hälfte des landesweiten Treibstoffes aus. Der Hafen ist Treffpunkt von Ost und West. Donau Logistik hat zwei Spurweiten für den Schienenverkehr angelegt, eine für Europa, eine für Strecken in die ehemalige Sowjetunion.
|

|
Von Tucher blickt von einem Aussichtspunkt über den Hafen. Zehn Meter hinter ihm stehen sich der moldauische und der ukrainische Grenzposten gegenüber. Der Ökonom ist viel durch das Land gefahren, um Kunden für den Hafen zu gewinnen. „Das Potenzial der moldauischen Landwirtschaft ist groß“, referiert er. Doch der einstige Obst- und Gemüsegarten der Sowjetunion müsse neue Absatzmärkte erschließen. Russland nutzte seine langjährige Alleinstellung als Abnehmer moldauischen Weins immer wieder als Druckmittel. Als das Land ein Assoziationsabkommen mit der EU schloss, stoppte Moskau die Einfuhr, angeblich wegen Qualitätsmängeln. Moldaus Winzer blieben auf hunderttausenden Flaschen sitzen.
Dass ein Staat seine wirtschaftliche Infrastruktur in die Hände ausländischer Investoren gibt, bewertet auch von Tucher als ungewöhnlich. Moldaus Regierung sah sich finanziell und fachlich nicht in der Lage, das Projekt umzusetzen. Hochverschuldet bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung übergab die Regierung die Verantwortung an einen ausländischen Investor. Donau Logistik zahlt nun Moldaus Schulden bei der EBRD zurück. Im Gegenzug erhielt das Unternehmen das Recht auf die Nutzung des moldauischen Donauzugangs, steuerfrei für 99 Jahre.
Ein schlechtes Geschäft für Moldau? „Man muss aber auch ehrlich sagen, sie haben es alleine nicht hinbekommen.“ Heute kann kein Moldauer ans Ufer der moldauischen Donau treten, ohne die Erlaubnis der deutschen Hafenbetreiber einzuholen. „Das stimmt,“ sagt von Tucher, während er am Ufer steht.
„Der Hafen hat Hoffnung gebracht"
Viele Menschen in Giurgiulești stecken trotzdem Hoffnung in den Hafen. Maria Niculiseanu lebt seit 34 Jahren in Giurgiulești. Grau meliertes Haar, fester Händedruck, eiserner Blick. Vor zehn Jahren sah sie vor der Krim erstmals ein Schiff mit der Aufschrift ihres Heimatdorfes. „Das machte mich stolz.“ Die Geographielehrerin erklärt, wie wichtig der Hafen für Moldau ist - wirtschaftlich, kulturell, politisch.
Von 104 Kindern an ihrer Schule leben nur zwölf nicht bei ihren Eltern. Ein niedriger Wert im „Land ohne Eltern“, wie Moldau aufgrund der hohen Auswanderung genannt wird. „Bei uns bauen junge Menschen sogar neue Häuser“, sagt sie, ja, der Hafen habe Hoffnung gebracht. Auch ihren Kindern? Bei der Frage steigen der stolzen Frau Tränen in die Augen. Alle drei leben im Ausland: Kanada, Deutschland und Rumänien.
Maria Niculiseanu hat drei Generationen im Dorf unterrichtet. Sie wünscht sich, dass ihre Schüler am Hafen Arbeit finden, um das Land nicht verlassen zu müssen, wie ihre Kinder es taten. Eine ihrer ehemaligen Schülerinnen ist die Hafeninspektorin Aliona Arnaut. „All die Boote aus der ganzen Welt, das macht einfach Spaß. Wir öffnen das Tor nach Moldau. Und wir schließen es auch wieder.“ Wenn sie in fließendem Englisch über ihre Arbeit spricht, reißt sie die Augen weit auf, die Mundwinkel hoch und zeigt strahlend weiße Zähne.
Hat sie jemals mit dem Gedanken gespielt auszuwandern? Ihre Schwester wohnt wie viele Moldauer in Italien. Einmal lud sie sich eine App zum Italienisch Lernen herunter, nur aus Interesse. Ihr 14-jähriger Sohn Katalin entdeckte die App und löschte sie. Er möchte nicht, wie einige seiner Freunde, ohne Mutter aufwachsen.
Sie weiß, dass ihre Kollegen drüben in Galati, im rumänischen Hafen, für die gleiche Arbeit 1.000 Euro erhalten, sie lebt von zweihundert Euro. Trotzdem ist sie dankbar. Auch ihr Mann arbeitet im Hafen. Von ihren Gehältern können sie es sich leisten, das Haus ihrer Schwiegermutter auszubauen, in dem sie wohnen. Sie läuft über ihren Hof: „Komm mit, hier unten bauen wir noch eine Küche, schau.“ |

|
Dreihundert Dorfbewohner arbeiten am internationalen Freihafen, jeder Zehnte aus dem Ort. Die Bürgermeisterin Tatiana Gălățeanu sieht daher „eine gute Partnerschaft“ mit den ausländischen Hafenbetreibern. Sie weiß aber, dass viele darüber klagen, nur die schlecht bezahlten Jobs zu bekommen. Für höhere Positionen werden Menschen aus der Stadt Cahul, aus der Hauptstadt Chișinău oder gar aus dem Ausland geholt. Auch die Probleme mit dem Verkehr kennt sie. Sie kämpft seit Jahren für eine Umgehungsstraße. Ohne Erfolg.
Der Einfluss der Bürgermeisterin ist minimal. Dass hoher Besuch aus der Hauptstadt kommt, aus dem Wirtschaftsministerium etwa, erfährt sie meist nur über Hafenarbeiter, die sie anrufen. Nur dann kann sie sich als Bittstellerin einmischen, uneingeladen beim Treffen zwischen ausländischen Unternehmern und nationaler Politik.
„Was also bleibt Moldau?"
Der Journalist Ilie Gulca hat lange über die Geschäfte rund um Giurgiulești recherchiert. Der größte Kunde am Freihafen ist das Unternehmen Transoil Group mit Sitz in der Schweiz. Inhaber ist ein russischer Oligarch, der den moldauischen Getreidemarkt dominiert. Der Hafen gehört einem niederländischen Unternehmen, das keine Steuern zahlt. „Was also bleibt Moldau?“ fragt er.
Die Bundesstraße, die am Hafen vorbeiführt, schläft nie. Vier Tankstellen stehen auf wenigen hundert Metern, Tag und Nacht für die Lastwagenfahrer geöffnet. Technomusik dröhnt aus einer Werkstatt-Garage, Zollbeamte und Soldaten gehen vorbei. Kurz vor der Zollkontrolle gibt es eine Bar, das einzige gastronomische Angebot Giurgiuleștis. Treffpunkt für Truckfahrer, Reisende und Dorfbewohner. Eine Gruppe junger Männer aus dem Dorf sitzt zusammen. Sie trinken, rauchen, spielen Karten.
Hat der Hafen ihr Leben verändert? Sie spielen weiter, lachen kurz. „Gar nichts hat sich geändert. Jeder von uns sucht nach Arbeit in Europa. Am Hafen zahlen sie genauso schlecht wie überall sonst in Moldau“, sagt der 31-jährige Ion. Einer der jungen Männer zückt sein Smartphone. Eine Bildmontage zeigt einen Mann, der ein Plakat mit dem Wahlspruch des Präsidenten Igor Dodon hochhält: „Moldova Are Vitor“, Moldau hat Zukunft. Der Mann mit dem Plakat hat einen großen Urinfleck auf seiner Hose und ist offensichtlich betrunken. Ion lacht und zieht wieder an seiner Zigarette.
Ist es in Giurgiulești nicht besser als anderswo wegen des Hafens? „Ja, es ist ein bisschen besser – nicht wegen des Hafens, sondern wegen der beiden Grenzen: Viele bringen Benzin oder Zigaretten rüber. Eine Schachtel kostet hier nur einen Euro.“ Kleinschmuggel ist für sie attraktiver als die Arbeit an Moldaus Tor zur Welt. |
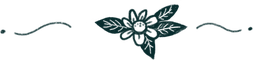
|
HINTER DER RECHERCHE
Ich wollte wissen, was der Hafen von Giurgiulești als einziger Meereszugang Moldaus für das Land bedeutet. Zunächst Internetrecherche, die Übersetzerin organisierte dann eine Unterkunft bei der Schwiegermutter einer Hafenarbeiterin. So hatte ich den ersten Kontakt vor Ort und zum Hafen. Parallel versuchte ich, den deutschen Hafendirektor zu erreichen. Vor Ort sprach ich mit den Einwohnern von Giurgiulești, LKW-Fahrern, dem Betriebsleiter des Hafenbetreibers, der Bürgermeisterin und mit Hafenarbeitern über die Bedeutung des Hafens für Moldau und das Dorf Giurgiulești, dabei waren mir neben der menschlichen Dimension des Themas auch die Zahlen und Fakten wichtig. |
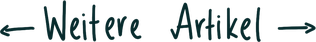

Violettes Licht statt schwarzer Erde — revolutioniert dieser Unternehmer den Ackerbau?
Auch diesen Sommer bleibt der Regen aus, Bauern fürchten um ihre Ernte. Ein Jungunternehmer tüftelt daran, den Ackerbau vom Wetter unabhängig zu machen.

Die geschwätzigste Bürgermeisterin des Landes
Die Bürgermeisterin Tatiana Badan hat tausend Ideen, ihr Dorf vor dem Aussterben zu retten. Der Einzige, dem das nicht gefällt, ist ihr Ehemann.
